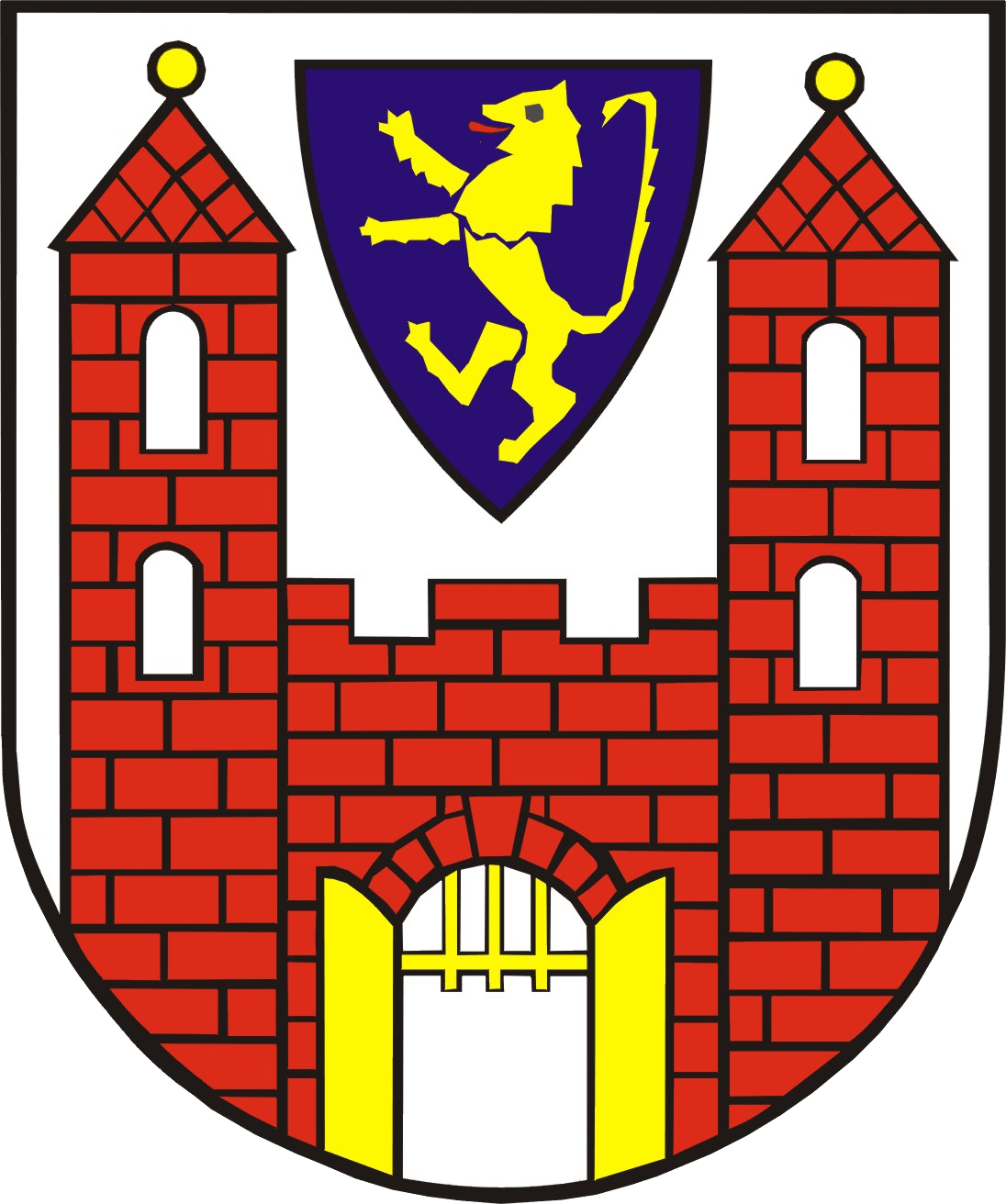Fehden um Egeln
Egeln, eine bedeutende Stadt am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen, musste im Mittelalter häufig Angriffe und Belagerungen ertragen, die jedoch meist nur spärlich und gelegentlich erwähnt werden.
So wurde Egeln 1251 vom Truchsess Johann von Alvensleben belagert. Im Auftrag des Bischofs von Halberstadt sollte er Otto von Hadmersleben die widerrechtlich eroberte Stadt und Burg Egeln wieder abnehmen, was ihm jedoch misslang. Daraus resultierten Vergleichsverhandlungen mit dem Bischof von Halberstadt, in denen sich dieser verpflichtete, auf die bei der Belagerung von Egeln aufgewandten Kosten zu verzichten.
Von tief einschneidender Wirkung war die Fehde von 1267, die Herzog Albrecht von Braunschweig-Lüneburg mit Herrn Otto von Hadmersleben austrug. Nach dem Kriegsbrauch jener Zeit wurde alles Land ringsum verheert; Haus und Hof wurden durch Brand geschädigt, um den Gegner seiner Hilfsquellen zu berauben. In einer alten Reimchronik über die Fürsten von Braunschweig heißt es darüber vom Herzog: „Sein mannliches Herz sich vermaß, dass er Egehlen auch besaß, des Herren gute Stadt, das noch viel Leute Wunder hat, wie er sie erwürbe, dass da nicht erstürbe viel mancher werte Mann, ehe denn er sie gewann.“
Wirklich gelang es Albrecht, die Stadt, die damals nur von Erdwällen geschützt war, zu erobern. Man muss arg gehaust haben; denn Klein-Börnecke erscheint seitdem wüst. Die St. Petrikapelle und die Klosterkirche in Egeln wurden dem Erdboden gleichgemacht, die Stadtkirche so beschädigt, dass ein völliger Neubau erforderlich wurde. Allerdings setzten sich die Bischöfe von Halberstadt und Magdeburg für Otto von Hadmersleben ein, sodass er Stadt und Burg behalten konnte, während der Herzog von Braunschweig die Beute des Überfalls behielt. Damit sich die Stadt Egeln schneller von dieser Verwüstung erholen konnte, wurden der Bevölkerung weitere Privilegien und Märkte bewilligt sowie die Stadt mit einer starken Mauer und doppelten Toren versehen. In dieser Zeit erhielt Egeln auch das Stadtrecht.
Von weiteren Fehden in den nächsten Jahrzehnten ist nichts Näheres zu erfahren. Aber das Stegreif-Rittertum muss auch hier schlimm gewütet haben, weil sich der Erzbischof Dietrich von Magdeburg 1362 genötigt sah, durch Errichtung eines „Landfriedens“ den räuberischen Gewalttätigkeiten der adligen Stellmeister und Schnapphähne einen kräftigen Damm entgegenzusetzen; denn die Sicherheit auf den Landstraßen war kläglich. Ungescheut überfielen die Raubritter von ihren festen Plätzen aus die Wanderer. So hatte Hans von Wanzleben 1351, ohne Fehde angesagt zu haben, einige Wagen voller Kaufmannsgüter der Magdeburger geraubt und auf sein Schloss gebracht. Andere hatten auf offener Straße Bürger ausgeplündert und Weidevieh von den Herden weggetrieben. Um die Räuber in Schach zu halten, wurde in Wanzleben eine Gegenveste errichtet und später (1373) Stadt und Schloss den Besitzern abgekauft, worauf die Stadt zur Hebung ihres Ansehens von Erzbischof Peter Invokavit 1376 das Stadtrecht erhielt. Noch durchgreifender wirkte die 1363 (im Jahr der Vollendung und Einweihung des Magdeburger Doms) unter den Fürsten, Domkapitularen, Stiften und Städten zwischen Elbe und Bode getroffene Abmachung, den Landfrieden mit bewaffneter Hand aufrechtzuerhalten. Atzendorf, Borne, Bisdorf, Wolmirsleben und Unseburg hatten 12 Gutsbesitzer und 27 Bauern, Wanzleben 30 Mann zu stellen.
Egeln gehörte damals noch nicht zum Erzstift Magdeburg und war daher nicht an die Abmachungen gebunden. Dass dem Erzbischof Dietrich wirklich ernst daran lag, die Adligen von ihrer Freibeuterei zu heilen, zeigt die Belagerung von Egeln 1364. Die Egelenser hatten vermutlich, um sich ein gutes Lösegeld zu verschaffen, einen Herrn von der Schulenburg auf seiner Reise nach Magdeburg gefangen genommen. Dietrich rückte sofort vor die Stadt und zwang die Bürger, den Gefangenen freizulassen und an den Wagen zu liefern.
Kurz darauf (1367) wurde der Landfrieden wieder bedroht. Ein Ludolf von dem Knesebeck hatte von Landsassen des Erzbischofs einigen Schaden erlitten. Aus Rache nahm jener den Magdeburgern Kaufmannsgüter im Wert von 800 Mark Silber weg und brachte sie auf sein Schloss Brome im Drömling. Der Erzbischof verbündete sich deshalb mit Magdeburg, Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben, zog gegen das Schloss Dumburg auf dem Hakelwalde und belagerte dort Ludolfs Bruder Erich. Ehe es zum Sturm kam, wurde ein Vertrag geschlossen, in dem die Herausgabe des Geraubten und eine Buße gelobt wurden. Wie arg die Besitzer der Dumburg in der Gegend auftraten, zeigen noch die darüber umlaufenden Sagen.
Unter den Trümmern der später zerstörten Ritterfeste Dumburg, deren Ruinen noch heute aus dem prächtigen Eichenwald malerisch hervorlugen und alljährlich das Ziel vieler fröhlicher Wanderer sind, sollen unermessliche Reichtümer an Gold, Silber und Kleinodien liegen, die von den ehemaligen Raubzügen herrühren. Ein armer Holzhauer sah einst einen Mönch in das unterirdische Gewölbe schleichen. Er folgte ihm und fand dort große Schätze. Eine Geisterstimme ermunterte ihn mit freundlichen Worten, zuzugreifen und seine Besuche zu wiederholen. Als der geizige Nachbar des plötzlich reich gewordenen Holzhauers hinter das Geheimnis kam und sich mit einem Eselskarren auf den Weg machte, um die Schätze gleich in Säcken fortzuschleppen, wurde er umgebracht; denn über den funkelnden Schätzen der Tiefe sitzt der Teufel als Hüter. Wer sie ihm entwenden will, bekommt selbst Anteil an der Finsternis des Abgrundes. Dass es in dem alten Gemäuer nicht ganz geheuer ist, kann jeder erfahren, der um Mitternacht hier weilt. Um diese Stunde steigen beim fahlen Mondlicht die einstigen Raubritter als zwölf weißgekleidete Geistergestalten herauf. Sie tragen einen offenen, mit Totengerippen und zerschmetterten Schädeln angefüllten Sarg über den Schlosshof, wobei sich tiefe Seufzer und murmelnde Gebete vernehmen lassen. Die Ruhelosigkeit im Grabe gilt dem Volke als das wohlverdiente Los der Raubritter für die ruchlose Plünderung und Ermordung friedlicher Bürger und Bauern.
Von der Dumburg rückte der Erzbischof sogleich vor die Burg Stecklenberg am Harz, ein Schloss der Grafen von Hadmersleben-Egeln, in welchem sich Räuber eingenistet hatten. Es wurde genommen und zerstört. Dann ging der Zug der Verbündeten ins Hildesheimische vor das Schloss Walmodena. Kirchen und Dörfer wurden auf dem Wege verbrannt. Der Bischof Gerhard von Hildesheim errang jedoch nach blutiger Schlacht einen glänzenden Sieg bei Dinklar (1367). Der Bischof von Halberstadt, der Edle Herr von Hakeborn und Herzog Magnus von Braunschweig wurden gefangen genommen. Fünfzehn Hundert sollen gefallen sein. Darunter befanden sich der Fürst von Anhalt, die Herren von Querfurt und der Edle Hans von Hadmersleben.
Da letzterer ohne Erben war, erhob eine Nebenlinie Ansprüche auf Egeln und besetzte es. Aber Erzbischof Dietrich, der seine Lehnsfolge zugestand, vertrieb sie nach drei Tagen aus der Stadt und nahm Stadt und Schloss Egeln als eröffnetes erzstiftliches Lehen in Besitz. Der Nachfolger Peter fand jedoch die Seitenlinie, Vettern des Verstorbenen, 1372 durch Geld ab und überließ ihnen, gegen Verzicht auf Hadmersleben, Egeln, das nun noch fast 50 Jahre in ihrem Besitz blieb.
Als Erzbischof Peter sich in Begleitung vieler bewaffneter Magdeburger nach seiner neuen Besitzung Hadmersleben begab, überfielen ihn beutelustige Hildesheimer Ritter. Sie wurden jedoch in die Flucht geschlagen, bis Kroppenstedt verfolgt, zum Teil auch gefangen genommen und gezwungen, sich mit einer bedeutenden Geldsumme auszulösen.
Ähnlich erging es den Grafen von Wernigerode für ihre Räubereien. Von Erzbischof Ludwig mit Krieg überzogen, verloren sie ihre unabhängige Stellung und wurden Lehnsvasallen des Erzstiftes. Sie hatten es wohl verdient. Wie kühn und verwegen sie gewesen waren, zeigt ein altes Gedicht, in dem auch Egelenser eine Rolle spielen. Im Bunde mit dem Herrn zu E
geln, Regenstein und Erxleben hatten die Wernigeröder 1372 gegen die Stadt Stendal in der Altmark einen Beutezug ins Werk gesetzt. Die Veranlassung gibt das alte Lied so an:
„Herr Busse Erxlewe sich vermaß auf dem Hufe, da er saß: Wäre ich fünfhundert stark, ich würde viele Kühe wegnehmen wohl aus der Altmark!“ Gebhard von Runstedt unterstützte diesen Plan und wies die Plünderungslustigen nach Stendal, weil hier das Land „noch unberührt und unverbrannt“ war. Solches unberührtes, von Einäscherung verschont gebliebenes Gebiet schien man gar nicht sehen zu können, ohne vor Neid zu platzen: „Da sei wohl viel zu nehmen!“ meinte der Runstedter, „Wir haben so viele starke Waffenträger. Wer würde uns das verwehren?“ Gesagt, getan. Der Zug kam bis Badingen. Doch die Herren hatten nicht den Patriotismus des dortigen Ortsvorstehers in Betracht gezogen. Sobald der „Schulte zu Badingen“ den Plan durchschaute, reiste er eilends nach Stendal vor das Tor und rief hier: „Wacht auf, ihr stolzen Bürger alle! Wollt ihr nichts mehr tun, so behaltet eure Kühe im Stall!“ Die Stendaler und die verbündeten Dörfer brachten Kühe und Schafe in einem Gehölz unter und legten sich beim Dorfe Meriz in einen Hinterhalt. Die Beutejäger fielen ihnen beim Anrücken nun selbst zur Beute.
„Sie schlugen Herrn Bussen auf den Kopf, dazu auf seinen Wappenrock und auf seine Pickelhaube. Da sah man so manchen stolzen Waffenträger wohl aus der alten Mark sich davonmachen. Werner von Calbe, der gute Mann, ritt die Feinde fest an. Sie griffen wohl zum Schwert: Wer nun ein ehrlicher Mann sein will, der stieg wohl auf die Pferde!“ Er wurde wohl durch und durch geritten. Das war der größte Schaden, den die von Stendal genommen haben. Gott gebe ihnen seine Gnade!“
Abgesehen von diesem Verlust ihres Bundesgenossen war große Freude über den Sieg. Der Rat und die Gildemeister von Stendal beschlossen, ihn alljährlich zu feiern und dabei für die Armen eine Mark und 1½ Talente Silber zu spenden. Von den so vortrefflich heimgeleuchteten Gegnern heißt es jedoch: „Das beweinte Herrn Bussens Frau und so manche stolze Dame.“ Wie viele von den Egelner Burgmannen ihrer eigenen und der Fehdelust ihres Herrn zum Opfer fielen, wird nicht gesagt.
Dass die Bürgerschaft zu Egeln nicht immer ganz unschuldig über die Stränge geschlagen haben muss, beweist der große und kleine Bann, mit welchem die Stadt – wie es heißt: „aus verschiedenen Ursachen“ – von Seiten der Kirche belegt wurde. Solche Strafe des Interdikts wurde damals als ein harter Schlag empfunden. Alles Läuten der Glocken war verboten. Keine Taufe, keine Trauung, keine Kommunion und kein kirchliches Begräbnis durfte gehalten werden. Die Äbtissin und das Kloster außerhalb der Mauern der Stadt Egeln wandte sich wegen dieser Angelegenheit (1414) an Papst Johann XXIII. und bat um Ausschluss vom Bann. Der Papst gewährte ihnen unter dem 3. Januar von Konstanz aus die Bitte. Doch mussten die Klosterleute, solange Egeln dem allgemeinen und speziellen Bann unterworfen war, Messe und sonstige Gottesdienste bei verschlossenen Türen und unter Ausschluss der gebannten Bürger halten. „Keinem Menschen“, schließt drohend das päpstliche Breve, „ist es gestattet, dieses Blatt mit unserer Konversion zu brechen oder ihm mit freventlichem Übermut entgegenzugehen. Würde das aber jemand wagen zu versuchen, der möge wissen, dass auf ihn der Unwille des allmächtigen Gottes und der seligen Apostel Petrus und Paulus fallen wird!“
Vom Ortschronisten - Uwe Lachmuth